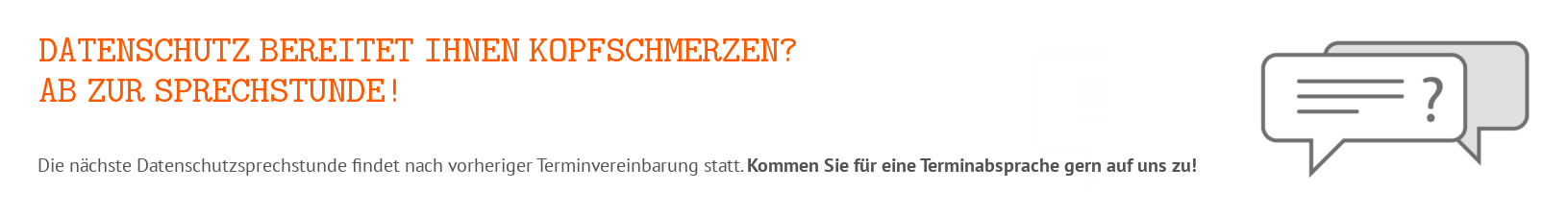
Wie in unserem Beitrag der letzten Woche bereits angedroht, soll zumindest noch eine zweite Frage zu Art. 15 DS-GVO behandelt werden, die einige „Sprengkraft“ besitzt, trotzdem bisher in der Fachliteratur noch weitestgehend unberücksichtigt blieb:
Frage
Nachdem ein Verantwortlicher und eine betroffene Person lange über einen Auskunftsanspruch gestritten haben, hat man sich letztlich „glücklich“ geeinigt. Die betroffene Person erhält eine Auskunft sowie womöglich noch weitere Leistungen und verzichtet auf weitergehende Ansprüche. Ist ein solcher Verzicht überhaupt rechtswirksam oder kann die betroffene Person zwei Tage später einen neuen Auskunftsanspruch erheben?
Antwort: Bekanntlich erfreut sich das Auskunftsrecht nach Art. 15 DS-GVO momentan und schon seit einigen Jahren großer Beliebtheit, wenn Beschäftigte – meist nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses – mit dem früheren Arbeitgeber, gleichgültig, ob Behörde oder Unternehmen, im Streit liegen und juristische Möglichkeiten suchen, die eigene Position zu verbessern. Der Auskunftsanspruch eignet sich dafür auf den ersten Blick sehr gut:
– Der Arbeitgeber ist zum Handeln gezwungen, ob er will oder nicht.
– Kosten dürfen dem Arbeitnehmer prinzipiell nicht berechnet werden.
– Für die Auskunftspflichten ist eine (Monats-)Frist gesetzt, die der Arbeitgeber zwar mit Begründung, aber nicht „unendlich“ verlängern kann.
– Bei Untätigkeit des Arbeitgebers ist die/der frühere Beschäftigte nicht auf ein Gerichtsverfahren angewiesen, das wiederum Kosten verursachen könnte, sondern kann auch für den Arbeitgeber unangenehme Beschwerde bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde führen.
– Der Arbeitgeber kann nicht „mit gleicher Münze“ antworten, weil ein Auskunftsanspruch zu seinen Gunsten nicht besteht.
Die arbeitsgerichtlichen Entscheidungen in erster und zweiter Instanz zu Art. 15 DS-GVO sind mittlerweile kaum noch überschaubar. Anfangs sorgte vor allem ein Urteil des LAG Baden-Württemberg für Furore (Urt. v. 20.12.2018, Az. 17 Sa 11/18). Der Arbeitgeber hatte dort ein in der Berufungsinstanz erhobenes Auskunftsbegehren des Arbeitnehmers nicht ausreichend ernst genommen und pauschal die Auskunft mit Verweis auf nötige Geheimhaltung abgelehnt. Das LAG verurteilte den Arbeitgeber umfassend zur Auskunft sowie Herausgabe einer entsprechenden Kopie. Das Revisionsverfahren beim Bundesarbeitsgericht endete durch Einigung zwischen den Parteien, also ohne Urteil des BAG. Diese sehr frühe Entscheidung zur DS-GVO (noch im Dezember 2018) hat den Blick vieler Arbeitsrechtler auf Art. 15 DS-GVO gelenkt und dafür gesorgt, dass die Auskunftsansprüche fortan häufiger z.B. in Kündigungsschutzverfahren auftauchten. Inzwischen geht die Tendenz der Arbeits- und Landesarbeitsgerichte (wenn man eine allgemeine Tendenz überhaupt feststellen kann) dahin, den Auskunftsanspruch mit verschiedensten Begründungen einzugrenzen. Juristisch sind diese Versuche oft wenig überzeugend und wirken gekünstelt, weil der (europarechtlich, also nationale Normen verdrängende) Art. 15 DS-GVO tatsächlich nach seinem Wortlaut sehr weitgehende Forderungen erlaubt.
Letztlich wird – wie immer bei der Auslegung von EU-Recht – der Europäische Gerichtshof entscheiden. Bisher hatte er dazu aber keine Gelegenheit, weil die deutschen Arbeitsgerichte Rechtsfragen zu Art. 15 DS-GVO nicht dem EuGH vorlegen, sondern selbst entscheiden.
Arbeitgeberseits liegt die Idee nahe, Rechtsunsicherheit durch Einigungen („Vergleichsabschlüsse“) zu beseitigen. Den Arbeitnehmern als „betroffenen Personen“ wird der Auskunftsanspruch gelegentlich „abgekauft“. Dabei stellt sich jedoch – bei etwas genauerem Hinsehen – die Frage: Funktioniert das? Und zwar rechtssicher? Beim Auskunftsanspruch nach Art. 15 DS-GVO handelt es sich um zwingendes Recht, also eine Rechtsposition, die die betroffene Person jedenfalls für die Zukunft nicht aufgeben kann. Wäre es anders, würden betroffene Personen landauf und landab von den Verantwortlichen gebeten, entsprechende Verzichtserklärungen zu unterschreiben.
In der Fachliteratur wird – soweit man das Thema erörtert – meist auf das Verbot missbräuchlichen und widersprüchlichen Verhaltens verwiesen. Diese Überlegung trägt aber nicht sicher: Wenn man wegen des zwingenden Charakters der Betroffenenrechte einen Rechtsverzicht ausschließt und für unwirksam hält, kann man betroffenen Personen kaum verweigern, dass sie sich auf diese Unwirksamkeit ihres Verzichts dann berufen und wieder Auskunft verlangen.
Eine Kontrollüberlegung führt in das nationale Mindestlohngesetz (MiLoG): Auch der Verzicht auf Mindestlohnansprüche ist gesetzlich ausgeschlossen. In § 3 Satz 2 MiLoG wird davon ausdrücklich nur der Verzicht auf entstandene Ansprüche und auch nur „durch gerichtlichen Vergleich“ ausgenommen. Mit anderen Worten: Auch wenn Arbeitnehmer ausdrücklich auf Mindestlohnansprüche verzichten, ist dies unwirksam, außer dies geschieht durch gerichtlichen Vergleich und bezogen auf Ansprüche der Vergangenheit. Nun mag man versucht sein, dies auf Art. 15 DS-GVO zu übertragen. Nur: Die Ausnahme (Wirksamkeit eines Verzichts in einem gerichtlichen Vergleich) findet sich nicht im Gesetzestext. Ob der EuGH sie in die DS-GVO „hineinliest““, bleibt abzuwarten.
FAZIT
Momentan könnte eine praktische Empfehlung lauten: Verzichtserklärungen sollten jedenfalls ausdrücklich auf die Vergangenheit, d.h. auf Datenverarbeitungen bis zum Tag der Einigung, begrenzt werden. Weitergehende Verzichte auch für die Zukunft haben keine Wirksamkeits-Chance. Außerdem sollte zusätzlich festgeschrieben werden, dass betroffene Person und verantwortliche Stelle (Arbeitnehmer und Arbeitgeber) einig darüber sind, dass alle rechtlich geschuldeten Auskünfte bis zum Tag der Einigung einwandfrei und vollständig erteilt wurden. Eine solche Verständigung darüber, dass Ansprüche für die Vergangenheit erfüllt sind, ist juristisch nicht dasselbe wie ein Verzicht. Man bestätigt ja nicht, dass man etwas nicht haben will, sondern dass man es ausreichender Art und Weise bereits erhalten hat. Ähnlich wird im Arbeitsrecht z.B. mit Urlaubsansprüchen verfahren, wenn anstelle des – gesetzlich unzulässigen – Urlaubsverzichts die Beteiligten gemeinsam festhalten, dass der Urlaub vollständig in Natur gewährt wurde. Auch das Steuerrecht kennt entsprechendes Vorgehen bei der sogenannten „tatsächlichen Verständigung“: Die Finanzämter dürfen sich mit Steuerpflichtigen nicht über Rechtsfragen „vergleichen“, sich aber bei strittigen Fragen mit ihnen über den Sachverhalt „verständigen“.
Über den Autor: Prof. Dr. Ralph Wagner ist Vorstand des DID Dresdner Institut für Datenschutz, Vorsitzender des ERFA-Kreis Sachsen der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. (GDD) sowie Mitglied des Ausschusses für Datenschutzrecht der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK). Als Honorarprofessor an der Technischen Universität Dresden hält er regelmäßig Vorlesungen und Seminare zum Thema Datenschutzrecht. Für Anregungen und Reaktionen zu diesem Beitrag können Sie den Autor gern per E-Mail kontaktieren.




